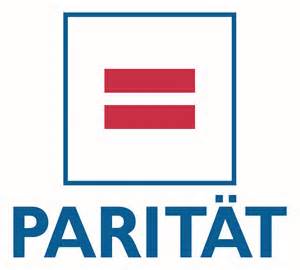Ausgangspunkt der Entscheidungen des EuGH bildeten die folgenden beiden Konstellationen:
- Als unbegleitete Minderjährige eingereiste Syrer wurden als Flüchtlinge anerkannt. Ihre Eltern beantragten die Erteilung von Visa zum Familiennachzug. Dieser Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass die in Deutschland lebenden Söhne der Familien zwischenzeitlich volljährig geworden waren (verbundene Rechtssachen Deutschland gg. SW, BL und BC, C-273/20 und C-355/20, asyl.net: M30811).
- Die syrische Staatsangehörige "XC" beantragte ein Visum zur Familienzusammenführung mit ihrem in Deutschland als Flüchtling anerkannten Vater. Auch ihr Antrag wurde abgelehnt, weil "XC" im Laufe des Verfahrens volljährig geworden war (Deutschland gg. XC, C-279/20, asyl.net: M30815).
Der EuGH hat nun entschieden, dass in beiden Konstellationen die Verweigerung der Visa gegen europäisches Recht verstoßen hat. In der Pressemitteilung des EuGH wird hierzu ausgeführt, dass die europäische Richtlinie betreffend das Recht auf Familienzusammenführung (Richtlinie 2003/86/EG, FamZ-RL) das Ziel verfolge, die Familienzusammenführung zu begünstigen und insbesondere minderjährigen Personen Schutz zu gewähren. Vor diesem Hintergrund sei es nicht mit der Richtlinie – und auch nicht mit der Charta der Grundrechte der EU – vereinbar, wenn die zuständigen Behörden den Zeitpunkt, zu dem sie über den Antrag auf Familienzusammenführung entschieden, als maßgeblich für die Beurteilung des Alters der betroffenen (ehemaligen) Minderjährigen nehmen würden. Bei diesem Vorgehen hätten die Behörden nämlich keine Veranlassung, die Anträge mit der gebotenen Dringlichkeit zu prüfen. Sie könnten somit in einer Weise handeln, die das Recht auf Familienleben gefährden würde. Außerdem würden die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Rechtssicherheit verletzt, weil die Erfolgsaussichten der Anträge auf Familienzusammenführung davon abhingen, ob sie von den nationalen Behörden mehr oder weniger zügig bearbeitet werden würden. Entsprechend wären die Erfolgsaussichten von Faktoren abhängig, die nicht "in der Sphäre des Antragstellers liegen".
Konstellation 1: Nachzug zu einem (ehemaligen) unbegleiteten Minderjährigen
Mit ähnlicher Begründung hatte der EuGH bereits im Jahr 2018 entschieden, dass eine Person, die zum Zeitpunkt ihrer Einreise und Asylantragstellung unter 18 Jahre alt war, aber während des Asylverfahrens die Volljährigkeit erreicht, als minderjährig im Sinne der Definition von Art. 2 Bst. f FamZ-RL anzusehen ist. Daher bestehe das Recht auf Familiennachzug nach Art. 10 Abs. 3 Bst. a FamZ-RL in dieser Konstellation fort (EuGH, Urteil vom 12.4.2018 – A. und S. gegen die Niederlande, C-550/16, asyl.net: M26143; siehe hierzu auch die Anmerkung von Heiko Habbe im Asylmagazin 5/2018, S. 149ff.).
Ungeachtet dessen hatte das Auswärtige Amt (AA) an seiner Auffassung festgehalten, wonach der Anspruch auf Familienzusammenführung bei Erreichen der Volljährigkeit verloren gehe. Nach Meinung des AA war die Entscheidung des EuGH vom April 2018 nur auf eine besondere Konstellation anwendbar, die im niederländischen Recht gegolten habe. Es hielt daher die Entscheidung für nicht übertragbar auf die deutsche Rechtslage (siehe die Meldung bei asyl.net vom 12.10.2018). Stattdessen bezog sich das AA weiterhin auf ältere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 18. April 2013 – 10 C 9.12 –, asyl.net: M20813). Das BVerwG hatte mit Blick auf den Nachzug von Eltern zu ihren Kindern entschieden, dass das Aufenthaltsrecht der Eltern "nicht in ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erwachsen kann" und deshalb die Minderjährigkeit zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Visumsantrag entscheidend sei.
Anders als das AA hatten demgegenüber die für Familiennachzugsverfahren zuständigen Gerichte in Berlin vertreten, dass das Urteil des EuGH auf die deutsche Rechtslage anwendbar ist. Unter anderem hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg im September 2018 geurteilt, dass der Nachzugsanspruch der Eltern eines (ehemals) unbegleiteten Minderjährigen durch den Eintritt von dessen Volljährigkeit nicht vereitelt werde (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 4.9.2018 – OVG 3 S 47.18, OVG 3 M 52.18 – asyl.net: M26617).
In seiner Entscheidung hat der EuGH diese Auffassung nun bestätigt und sich dabei offenbar auch eindeutig gegen die bislang vertretene Linie des AA bzw. des BVerwG positioniert: So weist er ausdrücklich darauf hin, dass die FamZ-RL einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der "das Aufenthaltsrecht der Eltern mit Eintritt der Volljährigkeit des Kindes endet" (zitiert nach der Pressemitteilung, Link siehe unten). Im Ergebnis stellt der Gerichtshof nochmals klar, dass der Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Familienzusammenführung für die Beurteilung der Minderjährigeneigenschaft des betreffenden Flüchtlings "nicht maßgebend" ist.
Konstellation 2: Nachzug einer (ehemals) Minderjährigen zu ihrem in Deutschland als Flüchtling anerkannten Vater
In diesem Fall kommt der EuGH zu dem Schluss, dass der maßgebende Zeitpunkt für die Feststellung der Minderjährigkeit des Kindes (hier: der Tochter "XC") der Zeitpunkt ist, zu dem der in Deutschland lebende Elternteil (hier: der Vater) den Asylantrag gestellt hat. Es kommt laut dem EuGH nicht darauf an, wann der Elternteil (hier der Vater) als Flüchtling anerkannt wurde und auch nicht darauf, wann der Antrag auf Familienzusammenführung gestellt wurde. Zur Begründung zieht der Gerichtshof im Wesentlichen dieselben Argumente heran wie bei seinen Ausführungen zur oben genannten ersten Fallkonstellation. Der Gerichtshof bestätigt damit zugleich die Argumentation des VG Berlin, das in einem Urteil vom 12.3.2019 einer Klage von "XC" stattgegeben hatte und die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet hatte, ihr ein Visum zum Zweck der Familienzusammenführung zu erteilen (Urteil vom 12.3.2019 - 12 K 27.18 V - asyl.net: M27731). Das VG Berlin war unter Berufung auf die oben zitierte Entscheidung des EuGH vom April 2018 zu der Auffassung gelangt, dass nicht der Zeitpunkt der Beantragung des Visums zum Zweck der Familienzusammenführung für die Beurteilung der Minderjährigeneigenschaft von "XC" maßgebend sei, sondern der Zeitpunkt der Asylantragstellung des Vaters. Das VG Berlin hatte dabei erklärt, dass es von der langjährigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts abwich. Dessen Rechtsprechung, wonach hinsichtlich des Erreichens der Volljährigkeit auf den Zeitpunkt des Nachzugsantrags abzustellen sei (u.a. BVerwG, Urteil vom 26.8.2008 – 1 C 32/07 –, asyl.net: M14389), sei nach dem genannten Urteil des EuGH nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Dass der EuGH diese Entscheidung des VG Berlin nun umfassend bestätigt hat, wird aller Voraussicht nach erhebliche Auswirkungen auf die Praxis des Familiennachzugs zu in Deutschland lebenden Flüchtlingen haben: Bislang galt hier, dass die Minderjährigkeit der im Ausland lebenden Kinder zum Zeitpunkt des Antrags auf Familienzusammenführung vorliegen musste. Indem der EuGH hier nun den Zeitpunkt der Asylantragstellung als maßgeblich betrachtet, sind derartige Anträge nun auch in den Fällen möglich, in denen im Ausland lebende Kinder während des laufenden Asylverfahrens (der Eltern) volljährig geworden sind.
Der EuGH weist in diesem Zusammenhang zugleich darauf hin, dass der Antrag auf Familienzusammenführung "innerhalb einer angemessenen Frist […], d.h. innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Anerkennung des zusammenführenden Elternteils als Flüchtling" gestellt werden müsse (zitiert nach der Pressemitteilung, Link siehe unten).
Zum Begriff der "tatsächlichen familiären Bindungen"
Weiterhin befasst sich der EuGH in seinen Entscheidungen mit der Frage, welche Intensität die Eltern-Kind-Beziehung in einer solchen Familiennachzugskonstellation aufweisen muss. Die bloße Verwandtschaft ersten Grades ist demnach nicht ausreichend für die Annahme "tatsächlicher familiärer Bindungen" im Sinne von Art. 16 Abs. 1 Bst. b FamZ-RL. Zugleich sei es für die Begründung eines Anspruchs auf Familienzusammenführung aber auch nicht erforderlich, dass die als Flüchtling anerkannte Person und ihr – gegebenenfalls mittlerweile volljähriges – Kind im selben Haushalt zusammenleben müssten. Vielmehr könnten "gelegentliche Besuche und regelmäßige Kontakte" ausreichend für die Annahme sein, dass die Betroffenen persönliche und emotionale Beziehungen wieder aufbauen wollten. Somit könnten derartige regelmäßige Kontakte auch als Beleg für das Bestehen tatsächlicher familiärer Bindungen ausreichen.
Rechtsprechung:
- EuGH, Urteil vom 1.8.2022 - Deutschland gg. SW, BL und BC, C-273/20 und C-355/20, asyl.net: M30811
- EuGH, Urteil vom 1.8.2022 - Deutschland gg. XC, C-279/20, asyl.net: M30815
- BVerwG, Vorlagebeschlüsse vom 23.4.2020 - 1 C 9.19, 1 C 10.19 - asyl.net: M28542 und 1 C 16.19 - asyl.net: M28541
- EuGH, Urteil vom 12.4.2018 - A und S gg. Niederlande - asyl.net: M26143
- EuGH, Urteil vom 16.7.2020 - B.M.M. u.a. gg. Belgien - asyl.net: M28868