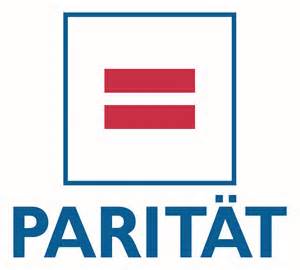Das Gesetz zur Modermisierung des Staatsangehörigkeitskrechts war Ende März 2024 im Bundesgesetzblatt erschienen, der größte Teil seiner Bestimmungen wird nun drei Monate nach der Verkündung wirksam. Die Änderungen betreffen vor allem das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), daneben werden als Folgeänderungen noch Regelungen angepasst, die das Meldewesen, die Ausstellung von Dokumenten sowie die Datenübermittlung betreffen.
Erleichterungen bei der Einbürgerung
Mit dem Gesetz wird das Prinzip aufgegeben, dass für eine Einbürgerung auf eine oder mehrere bestehende Staatsangehörigkeit(en) verzichtet werden muss. Dafür wurde der bisherige § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StAG gestrichen. Die damit verbundene Hinnahme von Mehrstaatigkeit hat auch zur Folge, dass umgekehrt auch die Annahme einer anderen Staatsangehörigkeit nicht mehr automatisch zum Verlust der deutschen führt (Aufhebung des bisherigen § 25 StAG).
Die deutsche Staatsangehörigkeit kann zudem nun früher als bisher von hier lebenden Menschen erworben werden: Die dafür maßgebliche Frist wurde von acht auf fünf Jahre des rechtmäßigen "gewöhnlichen" Aufenthalts reduziert (bei der Einbürgerung nach § 10 Abs. 1 StAG). Bei "besonderen Integrationsleistungen" kann die Frist auf drei Jahre verkürzt werden (§ 10 Abs. 3 StAG in der neuen Fassung).
Kinder, die ab dem heutigen 27. Juni 2024 in Deutschland geboren werden, erwerben die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn sich ein Elternteil seit fünf (bisher: acht) Jahren rechtmäßig in Deutschland aufhält (§ 4 Abs. 3 S. 3 Nr. 1 StAG in der neuen Fassung).
Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung
Als eine grundlegende Voraussetzung gilt, dass Personen, die eingebürgert werden wollen, den Lebensunterhalt für sich und für unterhaltsberechtigte Familienangehörige regelmäßig aus eigenen Mitteln bestreiten müssen. In diesem Bereich hat es aber eine Änderung gegeben, die in der Praxis voraussichtlich zu Schwierigkeiten in der Rechtsanwendung führen wird: Bislang galt eine generelle Ausnahme vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung. Demnach war die Inanspruchnahme von Sozialleistungen (nach SGB II oder SGB XII) "unschädlich", wenn die betroffene Person den Bezug dieser Leistungen "nicht zu vertreten" hatte (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StAG in der alten Fassung). In der neuen Fassung dieser Norm werden nun nur noch bestimmte Personengruppen genannt, bei denen der Leistungsbezug "unschädlich" ist (u.a. Angehörige der sogenannten "Gast-" oder "Vertragsarbeitergeneration" sowie Personen, die in Vollzeit erwerbstätig sind und ergänzende Leistungen beziehen). Nicht mehr generell ausgenommen sind aber eine Reihe von Personengruppen, die nach bisheriger Rechtsauffassung den Leistungsbezug ebenfalls "nicht zu vertreten" haben: Hierunter fallen beispielsweise Jugendliche und Heranwachsende in einkommensschwachen Haushalten, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen, pflegende Angehörige und Rentner*innen.
Um diese Personengruppen nicht vollständig von der Einbürgerung auszuschließen, soll es künftig laut Innenausschuss des Bundestags ermöglicht werden, dass in entsprechenden Konstellationen die Härtefallregelung des § 8 Abs. 2 StAG zum Tragen kommt. Demnach "kann" zur Vermeidung einer "besonderen Härte" vom Erfordernis abgesehen werden, dass Einbürgerungsbewerber*innen sich und ihre Angehörigen "zu ernähren imstande" sein müssen. Der Innenausschuss hat die Bundesregierung aufgefordert, durch eine Klarstellung in den Vorläufigen Anwendungshinweisen zum Staatsangehörigkeitsgesetz (VAH-StAG) darauf hinzuwirken, dass diese Regelung künftig auch bei den oben genannten Personengruppen greifen kann. Hierzu hat der Innenausschuss aufgeführt (BT-Drs. 20/10093 vom 17.1.2024, S. 9, externer Link zu bundestag.de):
"Dies kann etwa Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher, Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung und Alleinerziehende, die wegen Kinderbetreuung nicht oder nur in Teilzeit erwerbstätig sein können, betreffen. Ebenso pflegende Angehörige, Schülerinnen und Schüler/Auszubildende/Studierende, die, ggf. ergänzende, Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen, oder bei denen der elterliche Unterhaltsanspruch wegen des SGB-Leistungsbezugs der Eltern/des maßgeblichen Elternteils ins Leere geht. Für sie soll die Härtefallregelung in § 8 Absatz 2 zum Tragen kommen, wenn sie alles objektiv Mögliche und subjektiv Zumutbare unternommen haben, um ihren Lebensunterhalt dauerhaft zu sichern. Dies ist bei der künftigen Auslegung der Härtefallregelung in § 8 Absatz 2 zu berücksichtigen."
Allerdings sind von der hier genannten Norm des § 8 Abs. 2 StAG nur "besondere Härten" umfasst. Dies wurde von der Rechtsprechung bislang so ausgelegt, dass diese Regelung nur in außergewöhnlichen Fällen Anwendung finden kann und nur dann, wenn die Verweigerung der Einbürgerung diese besondere Härte erst hervorruft. Daher ist es fraglich, ob sich die vom Innenausschuss vorgeschlagene Lösung für die aufgeführten Personengruppen als tragfähig erweist. Zudem hat - soweit bekannt - die Bundesregierung bislang auch noch keine entsprechende Anpassung der Vorläufigen Anwendungshinweise vorgenommen.
Für laufende Einbürgerungsanträge kann im Übrigen noch die alte Rechtslage gelten: Wurde der Antrag vor dem 23. August 2023 gestellt und wurde noch nicht bestandskräftig darüber entschieden, gilt nach einer Übergangsregelung, dass die alte Fassung des § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StAG anzuwenden ist, soweit diese Norm günstigere Bestimmungen enthält (§ 40a StAG neue Fassung).
Weitere Informationen
Einen Überblick über die Neuregelungen haben wir in unserer Meldung vom 26. März zusammengestellt (Link siehe unten). Darüber hinaus hat Rechtsanwalt Thomas Oberhäuser in einem Beitrag für das Asylmagazin 6/2024 die Neuregelungen umfassend dargestellt und kommentiert.