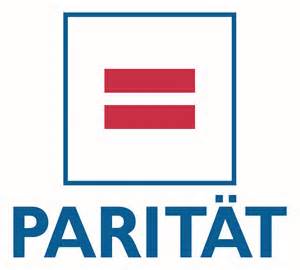Das Gesetz (BGBl. 2024 I Nr. 104 vom 26.3.2024, Link unten) war im Januar 2024 vom Bundestag und Anfang Februar 2024 vom Bundesrat verabschiedet worden. Es sieht einige Erleichterungen bei der Einbürgerung vor, für einige Personengruppen entstehen aber auch höhere Hürden. Außerdem werden die Anforderungen, die das Bekenntnis zu freiheitlich demokratischen Grundordnung und mögliche Ausschlussgründe betreffen, neu gefasst.
Erleichterungen von Einbürgerungen
- Hinnahme von Mehrstaatigkeit: Das Erfordernis, dass für die Einbürgerung auf die bestehende Staatsangehörigkeit verzichtet werden muss, entfällt (Streichung des § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StAG). Der Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit wird damit aufgegeben (so auch die Gesetzesbegründung, BT-Drucksache 20/9044, Link unten, S. 34). Die Gesetzesbegründung führt hierzu weiter aus, dass andere Aspekte – etwa Sprachkenntnisse, Bildung, berufliche Eingliederung, Lebensunterhaltssicherung, gesellschaftliche Teilhabe – für die Einbürgerung "weitaus wichtiger" seien als "die Frage, ob jemand eine oder mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt." Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass Mehrstaatigkeit schon jetzt bei den meisten Einbürgerungen hingenommen wird (besonders bei Staatsangehörigen von EU-Staaten oder bei in Deutschland geborenen Kindern in bi-nationalen Partnerschaften). Der Anteil von "Mehrstaatern" sei seit dem Jahr 2000 kontinuierlich gestiegen und habe im Jahr 2022 einen Anteil von 74,1% erreicht, ohne dass es dadurch zu "erkennbaren Problemlagen" gekommen sei. Schließlich sei durch die Aufgabe des Prinzips der Vermeidung von Mehrstaatigkeit eine erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung des Einbürgerungsverfahrens zu erwarten.
- Einbürgerung nach fünf Jahren: Künftig wird es möglich sein, sich nach fünf (bisher acht) Jahren des "gewöhnlichen Aufenthalts" in Deutschland einbürgern zu lassen, wenn verschiedene weitere Voraussetzungen erfüllt sind (Änderung von § 10 Abs. 1 S. 1 StAG). Zu diesen Voraussetzungen zählen insbesondere ein besimmter Aufenthaltstitel (Niederlassungserlaubnis, anderer unbefristeter Aufenthaltstitel oder eine der gesetzlich bestimmten Arten einer Aufenthaltserlaubnis), der Nachweis der Lebensunterhaltssicherung für sich selbst und für unterhaltsberechtigte Familienangehörige sowie ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache.
- Beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren: Die Frist für den notwendigen Voraufenthalt kann auf drei Jahre verkürzt werden, wenn zu den übrigen Voraussetzungen "besondere Integrationsleistungen" hinzukommen. Hierzu zählen insbesondere fortgeschrittene Deutschkenntnisse (Sprachniveau C1), besonders gute schulische, berufsqualifizierende oder berufliche Leistungen oder bürgerschaftliches Engagement (Änderung von § 10 Abs. 3 StAG).
- Einbürgerung von Kindern: In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern können künftig eingebürgert werden, wenn ein Elternteil seit fünf (bisher acht) Jahren seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat (Änderung von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 StAG).
- Neue berechtigte Personengruppen: Die Einbürgerung wird künftig auch für Personen möglich sein, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18d AufenthG (Aufenthalt zu Forschungszwecken) oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG (Aufenthaltsgewährung durch ein Bundesland im Rahmen eines Aufnahmeprogramms) besitzen (Änderung von § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StAG).
- Härtefallklausel: Ein neu geschaffener § 10 Abs. 4a StAG sieht vor, dass vom Erfordernis der "ausreichenden" deutschen Sprachkenntnisse abgesehen werden kann, wenn der Erwerb dieser Sprachkenntnisse "trotz ernsthafter und nachhaltiger Bemühungen nicht möglich ist oder dauerhaft wesentlich erschwert ist." In diesen Fällen soll es ausreichen, dass die Betroffenen sich "ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen" können. Für die Personen, die unter diese Härtefallregelung fallen, wird außerdem vom Erfordernis des "Einbürgerungstests" (Nachweis der Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland) abgesehen (neuer § 10 Abs. 6 S. 2 StAG).
- Erleichterungen für ehemalige "Gast-" und "Vertragsarbeiter": Eine ähnliche Regelung findet sich im ebenfalls neu geschaffenen § 10 Abs. 4 S. 3 StAG für Personen, die bis Juni 1974 als "Gastarbeiter" in die BRD oder bis Juni 1990 als "Vertragsarbeiter" in die DDR gekommen sind. Auch diese Personengruppen können die Anforderungen an die Sprachkenntnisse erfüllen, wenn sie sich "ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen" können und vom Erfordernis eines "Einbürgerungstests" wird abgesehen (neuer § 10 Abs. 6 S. 2 StAG). Begründet wird dies damit, dass die Angehörigen der sogenannten "Gastarbeitergeneration" in der BRD ebenso wie die "Vertragsarbeiter" der DDR in der Vergangenheit keine oder nur wenig Integrationsangebote erhalten haben (BT-Drucksache 20/9044, Link unten, S. 37).
Weniger Ausnahmen vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung
Ausnahmen vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung gelten künftig nur noch in bestimmten Fällen: Nach bisheriger Rechtslage war laut § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StAG die Einbürgerung auch bei Bezug von Sozialleistungen (nach SGB XII) bzw. Bürgergeld (SGB II) ausnahmsweise möglich, wenn die betroffene Person die Inanspruchnahme dieser Leistungen "nicht zu vertreten" hatte. Diese Ausnahmeklausel wird gestrichen. Stattdessen gelten Ausnahmen vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung künftig nur noch für
- Personen, die bis Juni 1974 als "Gastarbeiter" in die BRD oder bis zum Juni 1990 als "Vertragsarbeiter" in die DDR eingereist sind oder als Ehegatt*innen dieser Personen im zeitlichen Zusammenhang nachgezogen sind (neu: § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. a StAG);
- Personen, die in Vollzeit erwerbstätig sind und dies innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 20 Monate waren (neu: § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. b StAG) sowie Ehegatt*innen oder Lebenspartner*innen dieser Personen, wenn sie als mit einem minderjährigen Kind in familiärer Gemeinschaft zusammenleben (neu: § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. c StAG).
In der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass "einzelne Personengruppen die Voraussetzungen für einen Einbürgerungsanspruch nicht mehr erfüllen [können], auch wenn sie die erforderliche Unterhaltssicherung aufgrund von Umständen nicht erreichen können, die außerhalb ihrer Beeinflussungsmöglichkeiten liegen. Dies kann etwa Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung, pflegende Angehörige, Alleinerziehende, die wegen Kinderbetreuung nicht oder nur in Teilzeit erwerbstätig sein können, oder Schüler/Auszubildende/Studierende […] betreffen" (BT-Drucksache 20/9044, Link unten, S. 34). Für diese Personengruppen wird auf § 8 Abs. 2 StAG verwiesen, demzufolge "zur Vermeidung einer besonderern Härte" bei der Einbürgerung u.a. auch vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung abgesehen werden kann. Greifen soll diese Härtefallregelung künftig laut der Gesetzesbegründung dann, wenn die Betroffenen "alles objektiv Mögliche und subjektiv Zumutbare unternommen haben, um ihren Lebensunterhalt dauerhaft zu sichern." Dies sei bei der künftigen Auslegung des § 8 Abs. 2 StAG zu berücksichtigen, auch wenn die Gesetzesbegründung zugleich darauf verweist, dass eben diese Auslegung Behörden und Gerichten vorbehalten ist.
Durch eine Übergangsregelung in einem neuen § 40a StAG wird darüber hinaus klargestellt, dass die verschärften Anforderungen an die Lebensunterhaltssicherung nicht gelten, wenn der Einbürgerungsantrag bis zum 23. August 2023 gestellt wurde.
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit; Wegfall der Optionsregelung
- Der Grundsatz, demzufolge die deutsche Staatsangehörigkeit bei Annahme einer ausländischen Staatsangehörigkeit verloren geht, wird aufgegeben (Streichung von § 25 StAG). Dies ist laut der Gesetzesbegründung eine Folgeänderung, die daraus resultiert, dass das Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit generell aufgegeben wird (BT-Drucksache 20/9044, Link unten, S. 43).
- Aus demselben Grund wird auch § 27 aufgehoben, der bislang regelte, dass ein deutsches Kind bei Adoption durch eine ausländische Person die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren konnte.
- Ebenso wird § 29 StAG gestrichen, der die sogenannte Optionspflicht vorsah, wonach sich Personen mit mehreren Staatsangehörigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen nach dem 21. Geburtstag für die deutsche oder eine ausländische Staatsangehörigkeit entscheiden mussten. Diese Optionspflicht hatte keine große Bedeutung mehr, da sie bereits seit einer Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Dezember 2014 nur noch für eine kleine Gruppe von Personen galt, die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland erworben hatten, anschließend aber nicht hier aufgewachsen waren. Ausgenommen von der Optionspflicht waren außerdem auch zuvor schon Personen, deren zweite Staatsangehörigkeit die eines EU-Staates oder der Schweiz war.
- § 17 StAG, der die verschiedenen Optionen des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit enthält, wird neu gefasst: Zum einen enthält er nun in Abs. 1 eine – nun deutlich verkürzte – Aufzählung der Verlusttatbestände (1. Verzicht, 2. Eintritt in die Armee eines ausländischen Staates oder Beteiligung an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland, 3. Rücknahme einer rechtswidrigen Einbürgerung). In Absatz 2 werden zum anderen die Bestimmungen neu gefasst, nach denen ein Kind die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren kann, wenn die Erwerbsvoraussetzungen rückwirkend entfallen sind. Dies betrifft besonders Fälle, in denen eine Einbürgerung eines Elternteils oder die für den Staatsangehörigkeitserwerb maßgebliche Niederlassungserlaubnis eines Elternteils wegen Rechtswidrigkeit nachträglich unwirksam wurde. Daneben betrifft es Fälle, in denen die Vaterschaft, die für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit maßgeblich war, erfolgreich angefochten wurde. In der bisherigen Formulierung des § 17 StAG waren gerade die Fälle von Vaterschaftsanfechtungen nur indirekt erfasst bzw. waren die Voraussetzungen für den Verlust der Staatsangehörigkeit in diesen Fällen nicht ausdrücklich geregelt. Dies hatte das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 2013 als ungenügend kritisiert (BVerfG, Beschluss vom 17.12.2013 – 1 BvL 6/10 – Asylmagazin 3/2014, S. 92 ff., asyl.net: M21474, Rn. 83), erst jetzt werden im Gesetz aber die entsprechenden Klarstellungen vorgenommen. Ausdrücklich in Hinblick auf die Fälle von Vaterschaftsanfechtungen geregelt werden dabei nun u.a. auch die Konstellationen, in denen ein Verlust der Staatsangehörigkeit nicht erfolgen darf – beispielsweise, wenn das Kind das fünfte Lebensjahr bereits vollendet hat oder wenn ihm die Staatenlosigkeit drohen würde.
Ausschlussgründe
Bislang war die "Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse" als eine Voraussetzung für die Einbürgerung in § 10 StAG genannt. Dieses laut Gesetzesbegründung mit einem "unbestimmten Rechtsbegriff […] umschriebene" Erfordernis wird durch Streichung des letzten Satzteils von § 10 Abs. 1 S. 1 StAG aufgehoben (BT-Drucksache 20/9044, Link siehe unten, S. 32). Stattdessen werden zwei neue Tatbestände in § 11 S. 1 Nr. 3 StAG geschaffen, die zum Ausschluss von der Einbürgerung führen:
- In § 11 S. 1 Nr. 3 Bst. a StAG ist künftig zum einen geregelt, dass Personen, die mit mehreren Ehegatt*innen verheiratet sind, von der Einbürgerung ausgeschlossen sind (womit eine ähnliche Regelung aus dem bisherigen § 10 Abs. 1 S. 1 StAG hierhin verschoben wird).
- Zum anderen wird In § 11 S. 1 Nr. 3 Bst. b StAG ein neuer Ausschlussgrund geschaffen. Dieser betrifft Personen, die durch ihr Verhalten zeigen, dass sie "die im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau missachte[n]". Als Beispiele für ein entsprechendes Verhalten nennt die Gesetzesbegründung "Anhaltspunkte für ein Verhaftetsein in patriarchalischen Familienstrukturen", beispielsweise indem minderjährigen Töchtern oder Ehefrauen das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben abgesprochen wird (BT-Drucksache 20/9044, Link unten, S. 39).
Anforderung an das Bekenntnis zur fdGO
Das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung (fdGO) stellt nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 StAG eine Voraussetzung für die Einbürgerung dar. Die Anforderungen an dieses Bekenntnis wurden nun wie folgt erweitert:
- Mit § 10 Abs. 1 S. 2 StAG wird bei den Einbürgerungsvoraussetzungen der folgende Satz ergänzt: "Antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen sind mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und verstoßen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes." In den Vorläufigen Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern wurde der Text des Bekenntnisses zur fdGO um diese Formulierung ergänzt, sodass der neue Text bereits in der Praxis zur Anwendung kommt (Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/9044, Link unten, S. 35).
- In § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a StAG wird als "Unterpunkt" des Bekenntnisses zur fdGO die neue Einbürgerungsvoraussetzung geschaffen, wonach Einbürgerungsbewerber*innen "sich zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens, sowie zum friedlichen Zusammenleben der Völker und dem Verbot der Führung eines Angriffskrieges" bekennen müssen. Diese Erweiterung wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens durch den Innenausschuss des Bundestags ergänzt und war im ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung nicht enthalten (siehe Beschlussempfehlung, BT-Drs. 20/10093, Link unten).
- Ergänzend zu dieser Regelung wird in § 11 StAG ein neuer Ausschlussgrund geschaffen (neu: § 11 S. 1 Nr. 1a StAG): Demnach steht es künftig der Einbürgerung entgegen, wenn "tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen", dass das Bekenntnis zur fdGO einschließlich der genannten neu geschaffenen Erklärung nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a "inhaltlich unrichtig" ist. Auch diese Neuerung wurde durch den Innenausschuss des Bundestags ergänzt, der zur Erläuterung ausführte, dass sich "die Staatsangehörigkeitsbehörde und gegebenenfalls das Verwaltungsgericht die erforderliche Gewissheit davon zu verschaffen hat, ob das von Kenntnis getragene Bekenntnis auch der inneren Überzeugung entspricht." Damit solle verhindert werden, dass ein "reines Lippenbekenntnis" zur Einbürgerung führt. Sollten sich erst nachträglich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass im Zuge der Einbürgerung inhaltlich unrichtige Erklärungen abgegeben wurden, soll innerhalb der Frist von 10 Jahren gemäß § 35 StAG eine Rücknahme der Einbürgerung möglich sein (Beschlussempfehlung, BT-Drs. 20/10093, S. 11). Die Gesetzesmaterialien enthalten ansonsten keine Hinweise darauf, welche "Anhaltspunkte" künftig für die Annahme einer inhaltlich unrichtigen Erklärung maßgeblich sein sollen.
Abfragen und Datenübermittlungspflichten
- Die Einbürgerungsbehörden müssen künftig nachfragen, ob bei Verurteilungen wegen bestimmter Straftaten, die als Bagatelldelikte grundsätzlich nicht zum Ausschluss von der Einbürgerung führen würden, "antisemitische, rassistische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe" festgestellt wurden (neuer § 32b StAG), die der Einbürgerung entgegenstehen würden. Entsprechende Anfragen müssen sie an die zuständigen Staatsanwaltschaften richten, diese werden verpflichtet, die Ergebnisse ihrer Prüfung unverzüglich an die Staatsangehörigkeitsbehörde zu übermitteln.
- Nach § 37 Abs. 2 StAG sind im Einbürgerungsverfahren von den Staatsangehörigkeitsbehörden Auskünfte von den Verfassungsschutzbehörden einzuholen (Sicherheitsabfrage). Laut Gesetzesbegründung wird dieses Verfahren derzeit noch "weitgehend analog" durchgeführt und in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Durch Änderungen bzw. Einfügen verschiedener Vorschriften (Änderung von § 31 StAG, neuer § 32c StAG, Änderung von § 37 StAG) wird das Verfahren nun detailliert geregelt. Unter anderem wird festgelegt, welche Daten an welche Behörden übermittelt werden. Dafür genutzt werden soll künftig eine elektronische Kommunikationsplattform beim Bundesverwaltungsamt.
Inkrafttreten
Für die meisten der hier beschriebenen Bestimmungen des Gesetzes gilt, dass sie drei Monate nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt und somit am 26. Juni 2024 in Kraft treten werden. Ausnahmen betreffen die Regelungen zur Datenübermittlung in Zusammenhang mit "Sicherheitsabfragen" bzw. zur Datenübermittlungspflichten von und an die Staatsangehörigkeitsbehörden (unter anderem der o.g. neue § 32c StAG und die Neufassung von § 37 StAG). Diese Regelungen werden in Kraft treten, sobald das Bundeministerium des Innern im Bundesgesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen Voraussetzungen für die Datenübermittlung geschaffen wurden.