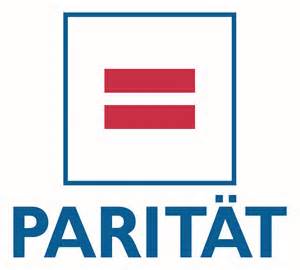Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten haben in verschiedenen Fällen die Verfahren ausgesetzt und ungeklärte Fragen, die die Auslegung von Unionsrecht betreffen, dem Gerichtshof der EU zur Entscheidung vorgelegt. Dabei geht es um die folgenden Themen:
- Zuständigkeit für die Asylverfahren von Schutzsuchenden nach der Dublin-Verordnung (Anwendbarkeit der Verordnung in bestimmten Konstellationen sowie Fragen zum Übergang der Zuständigkeit auf einen anderen Mitgliedstaat)
- Verantwortung für "Anerkannte", also für Personen, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Schutzstatus (Flüchtlingsschutz oder subsidiärer Schutz) erhalten haben.
Gerichte in Deutschland haben die anhängigen Vorabentscheidungsverfahren zum Anlass genommen, in ähnlich gelagerten Fällen die Verfahren auszusetzen oder Eilanträgen der Betroffenen gegen Unzulässigkeits-Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge stattzugeben. In diesem Zusammenhang hat sich auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) damit beschäftigt, wann Vorlagen an den EuGH verfassungsrechtlich geboten sind.
Kürzlich legte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) erneut dem EuGH Rechtsfragen vor, die Personen betreffen, die bereits Schutz in einem anderen europäischen Staat erhalten haben, in Deutschland aber (noch) einen Asylantrag stellten. In den meisten dieser Fälle machen die Betroffenen geltend, dass sie sich aufgrund schlechter Lebensbedingungen, die gegen ihre Rechte verstoßen, nicht in dem schutzgewährenden Staat niederlassen können. In solchen Fällen wird wie bei jeder Asylantragstellung in Deutschland zunächst geprüft, ob nicht ein anderer Mitgliedstaat nach der Dublin-Verordnung für die schutzsuchende Person zuständig ist. Die Tatsache, dass die betroffene Person bereits in einem anderen Mitgliedstaat als schutzberechtigt anerkannt wurde, wird regelmäßig erst während dieses Dublin-Verfahrens bekannt. In beiden Konstellationen, die sowohl Personen betreffen, die sich noch im Asylverfahren befinden, als auch solche, die in einem europäischen Land bereits als Schutzberechtigte anerkannt wurden, stellen sich jeweils unterschiedliche Rechtsfragen, die die Auslegung von Unionsrecht betreffen. Daher haben in solchen Fällen mehrere mitgliedstaatliche Gerichte ihre Verfahren ausgesetzt und diese Rechtsfragen dem EuGH im Vorabentscheidungsverfahren vorgelegt (einen ausführlichen Beitrag zu diesem Thema von Ralf Kanitz veröffentlichen wir im Rahmen eines Themenschwerpunkts „Rechtsschutz von Asylsuchenden vor internationalen Instanzen“ im demnächst erscheinenden Asylmagazin 7-8/2017).
Vorlagen in „Anerkannten“-Fällen
Zuletzt richtete das BVerwG am 27. Juni 2017 Vorlagefragen an den EuGH im Fall eines eritreischen Staatsangehörigen, der bereits in Italien als Flüchtling anerkannt wurde (1 C 26.16 – Pressemitteilung auf asyl.net, da Beschluss noch nicht vorliegt). Als klärungsbedürftig erachtet das BVerwG insbesondere die Frage, ob das BAMF einen Asylantrag einer bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat als Flüchtling anerkannten Person als unzulässig ablehnen darf, wenn die Lebensbedingungen für Anerkannte in dem anderen Staat nicht den Anforderungen der Folgerechte genügen, die in Art. 20 ff. Qualifikationsrichtlinie für Schutzberechtigte vorgesehenen sind.
Bereits im März 2017 hatte das BVerwG den EuGH (laufende Rechtssachen C-297/17, C-318/17 und C-319/17 – Ibrahim u.a.) um die Klärung von Fragen in drei Verfahren ersucht, in denen staatenlose palästinensische Personen aus Syrien in Bulgarien bereits subsidiären Schutz erhalten hatten (Beschlüsse vom 23.03.2017 - 1 C 17.16; 1 C 18.16; 1 C 20.16 – asyl.net: M25082). Das BVerwG fragt insbesondere, ob die Unzulässigkeits-Entscheidung ausgeschlossen ist, wenn die betroffene Person die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft begehrt (sogenanntes "Upgrade" oder "Aufstockung") und im Mitgliedstaat, der ihr subsidiären Schutz zugesprochen hat, systemische Mängel im Asylverfahren herrschen oder die dortigen Lebensbedingungen für Schutzberechtigte gegen ihre Rechte verstoßen.
Vorlage zu „Anerkannten“ in einem „Dublin“-Fall
Kurz vor diesem Beschluss des BVerwG hatte der VGH Baden-Württemberg dem EuGH einen Fall im Dublin-Verfahren vorgelegt. Der VGH setzt bezüglich der Frage nach den Lebensbedingungen für Schutzberechtigte noch früher an, nämlich schon während des Asylverfahrens (Beschluss vom 15.03.2017 - A 11 S 2151/16 – asyl.net: M24873). Der VGH ersucht den EuGH (laufende Rechtssache C-163/17 - Jawo) unter anderem um Klärung der Frage, ob bereits bei Asylsuchenden im Dublin-Verfahren von einer Überstellung abzusehen ist, wenn im eigentlich zuständigen Dublin-Mitgliedstaat (hier Italien) Menschenrechtsverletzungen für Schutzberechtigte drohen.
Entscheidungen in ähnlichen „Anerkannten“-Fällen
Mit Fällen, die denen, die dem EuGH vorgelegt wurden, ähnlich sind, wird von deutschen Gerichten sehr unterschiedlich umgegangen. Das VG Oldenburg (Beschluss vom 02.06.2017 - 1 B 2914/17 – asyl.net: M25136) hat z.B. unter Bezug auf den Vorlagebeschluss des VGH Baden-Württemberg im Fall eines bereits in Italien subsidiär schutzberechtigten jungen Mannes Eilrechtsschutz gegen den Unzulässigkeitsbescheid des BAMF gewährt: an der Rechtmäßigkeit einer Überstellung nach Italien bestünden ernstliche Zweifel, jedenfalls bis zur Entscheidung des EuGH über die Vorlage des VGH. So auch das VG Hannover mit sehr knappem Beschluss vom 28.06.2017 (4 B 7490/16 - asyl.net: M25199) unter Verweis auf die jüngste Vorlage des BVerwG.
Das BAMF geht wohl teilweise davon aus, dass aufgrund der beim EuGH anhängigen Vorabentscheidungsverfahren die Asylverfahren in gleichgelagerten Fällen auszusetzen sind. So wurde einer Rechtsanwältin unter Bezug auf den Vorlagebeschluss des BVerwG von März 2017 von einer Außenstelle mitgeteilt, dass das Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH zurückgestellt werde. Ob andere Außenstellen auch so vorgehen, ist hier nicht bekannt.
In Bezug auf Lebensbedingungen für Schutzberechtigte, die das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG beeinträchtigen könnten (hier Griechenland) hält es das BVerfG (Beschluss vom 08.05.2017 - 2 BvR 157/17 – asyl.net: M25069) für geboten, vorläufigen Rechtsschutz gegen die Unzulässigkeitsentscheidung des BAMF zu gewähren, wenn im gerichtlichen Eilverfahren die Umstände im anderen Staat nicht ausreichend beurteilt werden können. Zwar stehe Schutzberechtigten prinzipiell (nur) ein Anspruch auf Inländergleichbehandlung zu (also der Anspruch, in Hinblick auf staatliche Leistungen so behandelt zu werden wie die Staatsangehörigen des EU-Mitgliedstaats), jedoch sei die besondere Verletzlichkeit schutzberechtigter Personen zu berücksichtigen und es sei zu prüfen, ob sie tatsächlich Zugang zur staatlichen Versorgung haben. Andernfalls seien die Anforderungen an die Beurteilung der Aufnahmebedingungen in dem Abschiebungszielstaat aus Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG verletzt. Das VG Hamburg (Beschluss vom 11.05.2017 - 9 AE 2728/17 – asyl.net Dublin-Sammlung: M25119) gab in einem gleichgelagerten Fall dem Eilrechtsschutzantrag dennoch nicht statt und stellte auf die formale Gleichstellung von Schutzberechtigten mit griechischen Staatsangehörigen und der landesweiten Einführung von 200,- Euro monatlicher Sozialhilfe ab Anfang 2017 ab.
Das BVerfG bezieht sich in seiner Entscheidung auf den VGH Hessen (Urteil vom 04.11.2016 - 3 A 1322/16.A - asyl.net: M24415, Asylmagazin 1-2/2017, mit Anmerkung von RAin Magdalena Gajczyk), der festgestellt hatte, dass anerkannte Flüchtlinge Anspruch auf die Durchführung eines (weiteren) Asylverfahrens in Deutschland haben, wenn in dem schutzgewährenden Staat (hier Bulgarien) keine ausreichende Lebensbedingungen gewährleistet sind. Andere Gerichte hatten in solchen Fälle bisher lediglich Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 AufenthG hinsichtlich des schutzgewährenden Staates festgestellt (z.B. VG Gelsenkirchen, Urteile vom 19.02.2017 – asyl.net: M23770).
Anwendung der Dublin-Verordnung bei bereits subsidiär Schutzberechtigten?
Verfahrensrechtlich wurde bisher weitgehend davon ausgegangen, dass in Fällen, in denen Betroffene bereits internationalen Schutz in einem anderen europäischen Staat erhalten haben, die Dublin-Verordnung nicht anwendbar ist. Bei Gewährung subsidiären Schutzes aber nehmen nun manche Gerichte an, dass eine Teilablehnung (nämlich der Flüchtlingsanerkennung) erfolgte und deshalb die Dublin-Verordnung wie für vollständig abgelehnte Asylanträge gilt (siehe ausführlich hierzu Maria Bethke und Stephan Hocks, Asylmagazin 3/2017, S. 98 ff.). So entschied das OVG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 22.11.2016 - 3 B 2.16 – asyl.net: M24643, Asylmagazin 3/2017) im Falle einer in der Schweiz subsidiär schutzberechtigten Familie aus Afghanistan, ihr Asylantrag sei wegen des Ablaufs der Überstellungsfrist in Deutschland zu prüfen. Auch das OVG NRW (Urteil vom 22.09.2016 - 13 A 2448/15.A – asyl.net: M24332) ging im Fall eines in Italien subsidiär schutzberechtigten somalischen Staatsangehörigen von der Anwendbarkeit der Dublin-Verordnung aus, ohne jedoch Fristen oder Verfahrensgarantien der Verordnung anzuwenden. Trotz uneinheitlicher Auslegung des Unionsrechts legten die beiden Oberverwaltungsgerichte diese Fragen nicht dem EuGH vor.
Das VG Minden dagegen legte diese Frage mit Beschluss vom 19. Januar 2017 (10 K 6164/16.A – asyl.net: M24623) dem EuGH vor. Zudem fragte es, falls die Dublin-Verordnung auf subsidiär Schutzberechtigte anwendbar sein sollte, ob diese sich dann auf den Ablauf der Frist für die Stellung des Aufnahmegesuchs berufen können und ob diese Frist schon ab Asylgesuch oder erst ab förmlicher Asylantragstellung zu laufen beginnt. Der EuGH antwortete ungewöhnlich schnell per Beschluss am 5. April 2017 (C-36/17 Ahmed – asyl.net: M25181), da die Beantwortung keinen Raum für vernünftige Zweifel lasse (Art. 99 EuGH VerfO), dass die Dublin-Verordnung nicht auf Personen anwendbar sei, die in einem anderen Mitgliedstaat als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wurden. Damit erübrigten sich die weiteren Fragen des VG.
Vorlagen zu „Dublin“-Fällen
Das VG Minden (Beschluss vom 22.12.2016 - 10 K 5476/16.A – asyl.net: M24535, Asylmagazin 4/2017) hatte aber diese Fragen zum Drittschutz der Dublin-Fristen dem EuGH auch schon in einem klassischen „Dublin“-Fall gestellt. Hintergrund ist, dass der EuGH zunächst zwar in Bezug auf die Dublin-II-Verordnung grundsätzlich verneint hatte, dass Asylsuchende aus der Verordnung subjektive Rechte haben (Urteil vom 10.12.2013 - C-394/12, Abdullahi gegen Österreich – asyl.net: M21347), dies dann aber in Bezug auf einzelne Regelungen der Dublin-III-Verordnung bejaht hat (EuGH, Urteile vom 07.06.2016, Ghezelbash, C-63/15, asyl:net: M23883 und Karim, C-155/15, asyl.net: M23884; Ausführlich hierzu siehe hierzu Heiko Habbe, Asylmagazin 7/2016, S. 206 ff.). Der EuGH (laufende Rechtssache C-670/16 Mengesteab) behandelt diese Sache im beschleunigten Verfahren (Art. 105 Abs. 1 EuGH VerfO), die mündliche Verhandlung fand bereits statt und Generalanwältin Sharpston hat am 20. Juni 2017 ihre Schlussanträge vorgelegt. Sie geht davon aus, dass Asylsuchende sich auf den Ablauf der Frist für die Stellung des Aufnahmegesuchs nach Art. 21 Abs. 1 UAbs. 3 Dublin-III-Verordnung berufen können, und dass die Frist erst bei förmlicher Asylantragstellung und nicht bereits mit dem Asylgesuch zu laufen beginnt.
Unter Bezug auf das beim EuGH anhängige Verfahren gewähren einige Gerichte Eilrechtsschutz, weil sie wegen unklarer Rechtslage davon ausgehen, dass das individuelle Interesse an einer Aussetzung des Sofortvollzugs überwiegt. So z.B. das VG Braunschweig (Beschluss vom 31.01.2017 - 9 B 8/17 – asyl.net: M24760) in Bezug auf die Frist für das Ersuchen im Wiederaufnahmeverfahren aus Art. 23 Dublin-Verordnung.
Im laufenden Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache Mengesteab gehen sowohl der EuGH in seinem Beschluss über das beschleunigte Verfahren als auch die Generalanwältin in ihren Schlussanträgen auf die außergewöhnliche „Krisensituation“ 2015 ein, als die Zahl der Schutzsuchenden in Europa stark anstieg. In diesem Zusammenhang wurden dem EuGH weitere Fragen vorgelegt, die das Vorgehen der EU-Mitgliedstaten in dieser „Ausnahmesituation“ betreffen.
So fragt der Oberste Gerichtshof Sloweniens (Beschluss vom 14.09.2016, asyl.net: M24820) den EuGH (laufende Rechtssache C-490/16 A.S.), ob es sich überhaupt um einen "illegalen Grenzübertritt" handelt, der die Zuständigkeit des Mitgliedstaats der ersten Einreise nach Art. 13 Dublin-Verordnung begründet, wenn dieser Staat die Einreise zum Zweck der Durchreise in einen anderen EU-Mitgliedstaat organisiert und ob sich Asylsuchende darauf berufen können, dass die Zuständigkeit wegen Ersteinreise gar nicht begründet wurde. Der Verwaltungsgerichtshof Österreichs setzte daraufhin Verfahren aus, die eine solche Konstellation betreffen (siehe Meldung der Diakonie Österreich). Darüber hinaus fragt der VwGH Österreich (Beschluss vom 14.12.2016, asyl.net: M24821) den EuGH (laufende Rechtssache C-646/16 Jafari) unter Bezug auf die slowenische Vorlage, ob es sich bei der faktisch geduldeten Einreise in einen Mitgliedstaat, die allein dem Zweck der Durchreise in einen anderen EU-Mitgliedstaat dienen sollte, um ein "Visum" i.S.d. Art. 2 Bst. m und Art. 12 Dublin-III-VO handelt.
Die beiden Rechtssachen A.S. und Jafari werden vom EuGH gemeinsam im beschleunigten Verfahren behandelt (Art. 105 EuGH VerfO), die mündliche Verhandlung fand bereits statt und die Generalanwältin legte am 8. Juni 2017 ihre Schlussanträge vor. Sie geht zwar davon aus, dass die staatliche Praxis des „Durchwinkens“ nicht einer Visumserteilung im Sinne der Dublin-Verordnung gleichzustellen ist und auch keine visafreie Einreise nach Art. 14 Dublin-Verordnung darstellt. Allerdings kommt sie zu dem Schluss, dass die Gestattung der Grenzübertritte „unter den ganz außergewöhnlichen Umständen“ im Herbst 2015 und Frühjahr 2016 dazu führt, dass Asylsuchende in dieser Situation die Grenzen nicht „illegal überschritten“ haben und daher nicht nach Art. 13 Dublin-Verordnung der Staat der ersten Einreise zuständig ist. Vielmehr geht die Generalanwältin davon aus, dass derjenige Mitgliedstaat für das Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Asylantrag nach gestatteter Durchreise als erstes gestellt wurde. Schließlich meint sie, es sei eindeutig, dass Schutzsuchende sich auch darauf berufen können, dass nicht der Staat der ersten Einreise zuständig ist.
In einer sehr spezifischen Konstellation hatte das BVerwG bereits am 27. April 2016 (Beschluss - 1 C 22.15 – asyl.net: M23936, Asylmagazin 8/2016) den EuGH (laufende Rechtssache C-360/16 Hasan) um Klärung der Frage ersucht, ob die Regelungen der Dublin-Verordnung auch anwendbar auf Asylsuchende sind, die nach einer erfolgten Überstellung wieder in den Staat eingereist sind, aus dem sie überstellt wurden, und ob dann erneut ein Aufnahmeverfahren betrieben werden muss, in dem es auch zu einem Zuständigkeitsübergang kommen kann.
Uneinheitliche Entscheidungspraxis
Bereits aus dieser Auswahl von Entscheidungen zu „Dublin“- und „Anerkannten“-Fällen wird ersichtlich, dass die Spruchpraxis der nationalen Gerichte bei ungeklärten europäischen Rechtsfragen sehr uneinheitlich ist. Grundsätzlich ist unionsrechtlich auch vorgesehen, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten eigenständig auch über Fragen entscheiden, die das Europarecht betreffen; nur unter bestimmten Voraussetzungen sind sie verpflichtet dem EuGH vorzulegen (ausführlich hierzu: Beitrag von Ralf Kanitz im Themenschwerpunkt „Rechtsschutz von Asylsuchenden vor internationalen Instanzen“ im demnächst erscheinenden Asylmagazin 7-8/2017).
BVerfG und Vorlagepflicht
Mit den Fragen, ob die Vorlagepflicht verletzt ist und ob dies verfassungsrechtlich relevant ist, beschäftigt sich das BVerfG. Allerdings beanstandet es die Verletzung der Vorlagepflicht nur, wenn sie „offensichtlich unhaltbar“ ist. So wies es in einem Verfahren, welches den Aufenthalt türkischer Staatsangehöriger in Deutschland nach dem Assoziationsratsbeschluss (ARB 1/80) betraf, die Verfassungsbeschwerde zurück, obwohl es selbst erkannte, dass „Einiges dafür“ sprach, den EuGH anzurufen. Da aber Verfahrensbeteiligte keine konkrete Vorlagefrage formuliert hatten und sich das Fachgericht (hier BVerwG) mit dem Unionsrecht auseinandergesetzt hatte, befand das BVerfG die Nichtvorlage für verfassungsgemäß (Beschluss vom 20.02.2017 - 2 BvR 63/15 – asyl.net: M25064).
Einen Beschluss des VG Frankfurt/Oder, mit dem Eilrechtsschutz gegen einen Dublin-Bescheid versagt wurde, hob es aber auf. Laut BVerfG (Beschluss vom 17.01.2017 - 2 BvR 2013/16 – asyl.net: M24630, Asylmagazin 4/2017) besteht im Eilverfahren nach Rechtsprechung des EuGH zwar grundsätzlich keine Vorlagepflicht. Daher erkannte es in der Entscheidung des VG keinen Entzug des gesetzlichen Richters nach Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG. Allerdings sah das BVerfG in der Ablehnung des Eilantrags das Recht des Betroffenen auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG verletzt, da sich im Eilverfahren eine Frage stellte, die im Hauptsacheverfahren eine Vorlage an den EuGH erfordert hätte. Das VG hätte abwägen müssen, ob dem Betroffenen zugemutet werden kann, das Verfahren von einem anderen Mitgliedstaat (hier Bulgarien) aus zu betreiben. Für klärungsbedürftig erachtete das BVerfG die Frage, ob die Durchführung des in Art. 5 Dublin-Verordnung vorgeschriebenen persönlichen Gesprächs für die Rechtmäßigkeit der Unzulässigkeitsentscheidung beachtlich ist. Selbst meint das BVerfG, dass manches für Beachtlichkeit der unterlassenen Anhörung spricht. Im Zusammenhang mit den Fristen aus der Dublin-Verordnung deutet es an, dass es aufgrund des Beschleunigungsgebots vom früheren Fristbeginn bei Asylgesuch ausgehen würde (a.A. EuGH Generalanwältin: bei Asylantragstellung, siehe oben).