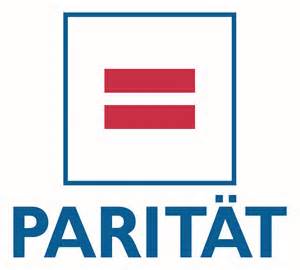Hintergrund: Zurückweisungen in den Jahren 2018 und 2019
Im Jahr 2018 hatte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Abkommen mit Griechenland und Spanien abgeschlossen, die zum Ziel hatten, dass bei der Einreise nach Deutschland aufgegriffene Personen unter weitgehender Umgehung des "Dublin-Verfahrens" in diese Länder abgeschoben werden sollten. Den auch als "Seehofer-Deals" bekannt gewordenen Abkommen war ein Streit in der damaligen Bundesregierung um die rechtliche Möglichkeit derartiger "direkter Zurückweisungen" an der Grenze vorausgegangen.
Das auf der Grundlage der "Seehofer-Deals" eingeführte Verfahren kam zur Anwendung bei Personen, die beim Versuch der Einreise über die österreichisch-deutsche Grenze überprüft wurden und bei denen sich nach dem Abgleich ihrer Daten mit der Eurodac-Datenbank herausstellte, dass sie bereits in Griechenland oder Spanien einen Asylantrag gestellt hatten. Üblicherweise führt ein solcher "Eurodac-Treffer" dazu, dass ein Dublin-Verfahren eingeleitet wird, in dem die Staaten untereinander die Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens abklären, in dem aber auch bestimmte Verfahrensgarantien einzuhalten sind. Anstelle der Einleitung eines Dublin-Verfahrens wurde den Betroffenen aber unter Berufung auf § 18 Abs. 2 Nr. 2 Asylgesetz die Einreise verweigert, wobei sie darauf hingewiesen wurden, dass ein anderer Staat zu ihrer Wiederaufnahme verpflichtet sei und ein "entsprechendes Auf- oder Wiederaufnahmeverfahren" eingeleitet worden sei. Innerhalb von 48 Stunden sollte dann die Abschiebung nach Spanien oder Griechenland erfolgen.
Im Jahr 2019 hatten deutsche Verwaltungsgerichte in einigen der Fälle interveniert und entsprechende Abschiebungen für rechtswidrig erklärt. Das VG München kam in einem grundlegenden Beschluss vom 8. August 2019 zu dem Ergebnis, dass es für das Verfahren weder im nationalen noch im europäischen Recht eine Grundlage gebe (VG München, Beschluss vom 8.8.2019, M 18 E 19.32238 – Asylmagazin 10-11/2019, S. 371 ff., asyl.net: M27488; siehe dazu auch die Beiträge von Bellinda Bartolucci im Asylmagazin 5/2019, S. 153–161, und im Asylmagazin 10–11/2019, S. 334–338 sowie den Beitrag von Anna Lübbe im Verfassungsblog vom 10. Mai 2019).
In der Folge der erwähnten Gerichtsentscheidungen kamen die Abschiebungen auf Grundlage der Verwaltungsabsprachen praktisch zum Erliegen, so wurde nach Auskunft der Bundesregierung im Jahr 2021 nur noch eine Abschiebung auf dieser Grundlage durchgeführt, zwischen 2022 und 2024 dann keine mehr. Ingesamt kam das Verfahren lediglich in 50 Fällen zur Anwendung (Bundestagsdrucksachen 20/14341, Frage 22, und 20/12757, Frage 25).
Die Entscheidung des EGMR, H.T. gegen Griechenland und Deutschland
Im Jahr 2024 befasste sich der EGMR mit der Rechtmäßigkeit des beschriebenen Verfahrens (EGMR, Urteil vom 15.10.2024 – 13337/19, H.T. gg. Deutschland und Griechenland – asyl.net: M32767). Kläger beim EGMR war der syrische Staatsangehörige "H.T.", der am 4. September 2018 an der österreichisch-deutschen Grenze gestoppt und noch am selben Tag nach Griechenland abgeschoben worden war. Dort war er auf die Insel Leros verbracht worden, wo er für mehrere Wochen in einer Polizeistation sowie in einem Container auf dem Gelände eines Aufnahmezentrums inhaftiert worden war. Erst nachdem er als Angehöriger einer vulnerablen Gruppe (in seiner Eigenschaft als Person mit einer Behinderung bzw. schwer erkrankte Person) identifiziert worden war, war er aus der Haft entlassen worden und ein neues Asylverfahren wurde durchgeführt. Dieses Verfahren führte im Jahr 2020 zu seiner Anerkennung als Flüchtling.
Deutschland und Griechenland wurden in diesem Fall wegen der Verletzung von Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (dem Verbot von Folter sowie unmenschlicher und erniedrigender Behandlung) verurteilt. In Bezug auf Deutschland war für das Gericht hierfür ausschlaggebend (Randnummer 150 des Urteils),
- dass die deutschen Behörden nicht allgemein davon ausgehen durften, dass der Schutzsuchende in Griechenland Zugang zum Asylverfahren haben würde, vor einer rechtswidrigen Abschiebung (refoulement) geschützt sein würde und ihm keine Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde,
- dass die Verwaltungsvereinbarung keine Garantien für den Zugang zum Asylverfahren und für den Schutz vor Verletzungen von Art. 3 EMRK vorsah und auch keine diesbezügliche individuelle Zusicherung vorlag,
- dass die deutschen Behörden nicht nachweisen konnten, dass sie sich vor der Abschiebung mit den genannten Risiken auseinandergesetzt hätten,
- dass der Schutzsuchende "übereilt" (hastily) abgeschoben wurde und keinen Zugang zu einem Rechtsbeistand hatte.
Bei der anschließenden Inhaftierung in Griechenland sei H.T. Bedingungen ausgesetzt gewesen, die gegen Art. 3 EMRK verstoßen hätten. Der Umstand, dass in Griechenland später ein Asylverfahren eröffnet wurde, ändere nichts an der Einschätzung des Gerichts, da das ursprüngliche Verfahren eben nicht weitergeführt worden sei. Vielmehr hätte nur aufgrund der Vulnerabilität des Betroffenen ein neues Verfahren stattgefunden, was zum Zeitpunkt seiner Abschiebung aus Deutschland weder garantiert noch vorhersehbar gewesen sei.
In einer ersten Einschätzung kommentierte das European Center for Constitutional and Human Rights, dass der EGMR "Verwaltungsabkommen wie dem Seehofer-Deal […] eine klare Absage" erteilt habe. Zugleich habe das Gericht den Zugang zum Rechtsschutz von Asylsuchenden an der Grenze gestärkt (siehe Mitteilung des ECCHR unter diesem Link).
Auswirkungen der Entscheidung des EGMR
Auf eine Anfrage der Gruppe Die Linke im Bundestag (BT-Drs. 20/15133 vom 19.3.2025, Antwort auf Frage 23, S. 47/48) hat die Bundesregierung nun mitgeteilt, dass das Urteil des EGMR am 15. Januar 2025 "endgültig" geworden ist, von Seiten Deutschlands also akzeptiert wird. Mit Verfügung vom 20. November 2024 habe das Bundespolizeipräsidium darüber hinaus die Zurückweisungen gemäß der Verwaltungsabsprachen mit Griechenland und Spanien bis auf Weiteres ausgesetzt.
Nachdem das Verfahren wegen der schwerwiegenden Bedenken an seiner Rechtmäßigkeit, die deutsche Gerichte geäußert hatten, nur selten zur Anwendung und später faktisch zum Erliegen gekommen war, ist nun nach der Entscheidung des EGMR klargestellt worden, dass Zurückweisungen auf dieser Grundlage bis auf Weiteres nicht möglich sind. Der EGMR hat in seiner Entscheidung erneut darauf hingewiesen, dass die Staaten auch bei Abschiebungen innerhalb Europas immer dazu verpflichtet sind, die Gefahr von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, insbesondere von Verletzungen der Rechte aus Art. 3 EMRK, zu prüfen.