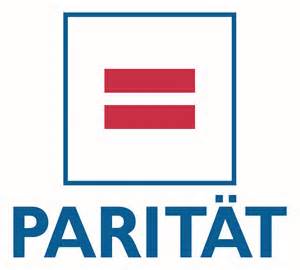In dem aktuellen Gutachten analysieren die Organisationen JUMEN e.V. - Juristische Menschenrechtsarbeit in Deutschland und Pro Asyl sowohl die rechtliche Regelung als auch die Praxis des Nachzugsverfahrens bei subsidiär Schutzberechtigten. Nach der seit August 2018 geltenden Regelung des § 36a AufenthG kann monatlich ein Kontingent von 1.000 Visa an Familienangehörige von subsidiär Schutzberechtigten erteilt werden (laufend aktualisierte Hinweise hierzu, siehe familie.asyl.net). Zuvor war der Nachzug zu subsidiär Geschützten knapp zweieinhalb Jahre komplett ausgesetzt gewesen - nur kurz, nachdem dieser Gruppe das Recht auf Familienzusammenführung wie bei anerkannten Flüchtlingen zugesprochen worden war. Wie bereits die Aussetzung wurde auch die Neuregelung im Gesetzgebungsverfahren scharf kritisiert und ist weiterhin umstritten (siehe Rechtsprechungsübersicht hierzu in Asylmagazin 6-7/2020).
In ihrem Gutachten stellen JUMEN und Pro Asyl hinsichtlich des Verfahrenssie fest, dass die betroffenen Familien aufgrund der intransparenten und bürokratischen Vorgehensweise – unter Beteiligung mehrerer Behörden – jahrelang hingehalten werden und dass aufgrund der Praxis des Auswärtigen Amts kaum die Möglichkeit besteht, gerichtliche Kontrolle zu erreichen. Dabei sei das Verfahren geprägt von langen Wartezeiten, die vorgesehene Priorisierung humanitärer Härtefälle finde nicht statt und das festgelegte Kontingent von 1000 Visa pro Monat werde bei weitem nicht erreicht (im Jahr 2020 seien nur etwa 44% des Kontingents ausgeschöpft worden).
Die Regelung selbst wird als rechtswidrig eingestuft, sie verstößt dem Gutachten zufolge gegen das Grundgesetz, die Europäische Menschenrechtskonvention, die EU-Grundrechte-Charta und die UN-Kinderrechtskonvention. Nur bei einer Abwägung der widerstreitenden Interessen, also der Berücksichtigung der familiären Belange im Einzelfall, wäre laut Gutachten eine Rechtmäßigkeit herzustellen. Als gesetzlicher Anknüpfungspunkt käme die sogenannte Härtefallregelung des § 22 AufenthG in Betracht.
Ein Verweis darauf war bei Schaffung des § 36a AufenthG ausdrücklich aufgenommen worden, nicht zuletzt, um solchen rechtlichen Bedenken zu begegnen. Damit sollte klargestellt werden, dass in Härtefällen der Nachzug auch über das monatliche Kontingent hinaus möglich sei. Eine Härtefallklausel war auch vor dem Hintergrund verschiedener Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts als grundrechtlich geboten angesehen worden. Jedoch waren im Gesetzgebungsverfahren aufgrund der bisherigen Verwaltungspraxis auch Befürchtungen geäußert worden, dass die Klausel des § 22 AufenthG ins Leere laufen könne.
Nunmehr geht aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, dass die Härtefallregelung in Fällen des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten in der Praxis tatsächlich nicht zur Anwendung kommt (BT‑Drs. 19/27462 vom 10.3.2021, Frage 25). Demnach wurden seit dem 1. August 2018 keine Visa nach § 22 AufenthG an Familienangehörige von subsidiär Schutzberechtigten erteilt. Die Bundesregierung erklärt die Nichtanwendung der Klausel in ihrer Auskunft damit, dass es in den Fällen, in denen Anträge darauf gestützt wurden, »an der Singularität des Einzelschicksals« gefehlt habe.
Im Gutachten wird festgestellt, dass gerade wegen des gesetzlich intendierten Regelungszwecks, nämlich, dass § 22 AufenthG über das Kontingent des § 36a AufenthG hinaus nur in extremen Ausnahmefällen den Nachzug ermöglichen solle, eine grundrechtlich gebotene angemessene Berücksichtigung der familiären Belange in jedem Einzelfall eben nicht gewährleistet wird.
Die betroffenen Familien würden indessen von jahrelangen Wartezeiten zermürbt. Prognosen zu Zuzugszahlen, die zur Begründung der Regelung angeführt worden waren, seien maßlos überhöht gewesen. Die Organisationen fordern daher die Abschaffung der Regelung, um den Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten, wie er bereits 2015 gesetzlich vorgesehen war, zu gewährleisten.