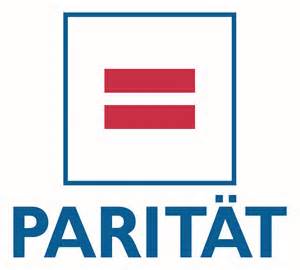In dem beim EuGH anhängigen Verfahren (Rechtssache Dano gegen Jobcenter Leipzig, C-333/13) geht es um eine alleinerziehende Rumänin, die 2010 mit ihrem Sohn nach Deutschland eingereist war. Sie war bislang weder in Rumänien noch in Deutschland erwerbstätig. Ihre Anträge auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende) wurden wiederholt abgelehnt. Ihre dagegen gerichtete Klage nahm das Sozialgericht Leipzig zum Anlass, den EuGH im Wege eines sogenannten Vorabentscheidungsverfahrens zu fragen, ob verschiedene Regelungen des SGB II mit europäischem Recht vereinbar sind.
Unstrittig ist, dass EU-Bürger unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Leistungen des SGB II in Deutschland haben können. Das SGB II sieht aber verschiedene Möglichkeiten vor, Ausländer von Leistungen nach diesem Gesetz auszuschließen, zum Beispiel während der ersten drei Monate des Aufenthalts oder auch darüber hinaus, wenn sich Personen nur zum Zweck der Arbeitssuche in Deutschland aufhalten. Strittig ist, ob diese allgemeinen Ausschlussklauseln auch auf EU-Bürger angewandt werden dürfen. So wird – u.a. von verschiedenen Landessozialgerichten – vertreten, dass EU-Bürger aufgrund vorrangiger europarechtlicher Vorschriften nicht wegen einer solchen allgemeinen Regelung von Leistungen des SGB II augeschlossen werden dürfen. Vielmehr sei ein Ausschluss nur im Einzelfall möglich, wenn die zuständigen Behörden ausdrücklich festgestellt haben, dass dem betroffenen EU-Bürger kein Aufenthaltsrecht in Deutschland zusteht. Nach dieser Auffassung hätten also auch die Klägerin und ihr Sohn so lange Anspruch auf Leistungen, bis die Ausländerbehörde über die Rechtmäßigkeit ihres Aufenthalts entschieden hat (vgl. hierzu auch den Beitrag von Eva Steffen im Asylmagazin 1-2/2014, S. 12ff.).
Generalanwalt Melchior Wathelet schließt sich dieser Auffassung in seinen Schlussanträgen zu diesem Verfahren nicht an. Vielmehr kommt er zu dem Ergebnis, dass es auch unter den Vorgaben des Europarechts möglich ist, EU-Bürger auf der Grundlage eines allgemeinen Kriteriums von Leistungen der Grundsicherung auszuschließen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn mit dem allgemeinen Kriterium "das Fehlen einer tatsächlichen Verbindung mit diesem Staat [hier: Deutschland] nachgewiesen werden kann und so eine übermäßige Belastung für das Sozialhilfesystem verhindert werden soll."
Das im deutschen Recht herangezogene Ausschlusskriterium – dass die Einreise nur zum Zweck der Arbeitssuche erfolgte oder nur, um Sozialhilfe zu beziehen – erfüllt nach Ansicht des Generalanwalts die genannten Voraussetzungen. Die deutschen Rechtsvorschriften erfüllten ein legitimes Ziel und seien auch verhältnismäßig.
Der Generalanwalt bezieht sich dabei in seinen Ausführungen zunächst auf Personen, "die weit davon entfernt sind, sich in den Arbeitsmarkt integrieren zu wollen". Entsprechend sind seine Schlussfolgerungen also nicht notwendigerweise auf EU-Bürger anwendbar, die bereits in Deutschland erwerbstätig waren. Diese Frage ist Gegenstand eines weiteren beim EuGH anhängigen Verfahrens, in dem zwei Schwedinnen gegen das Jobcenter klagen, weil zuvor gewährte "Hartz IV"-Leistungen eingestellt wurden. Sie waren zuvur in kürzeren Beschäftigungen bzw. Arbeitsgelegenheiten erwerbstätig gewesen. Das Bundessozialgericht hatte dieses Verfahren mit Beschluss vom 12.12.2013 dem EuGH ebenfalls zur Vorabentscheidung vorgelegt (Az. des BSG: B 4 AS 9/13 R).
Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den EuGH nicht bindend. Sie gelten aber als richtungsweisend, weil der Gerichtshof der Auffassung der Generalanwälte in der Vergangenheit häufig gefolgt ist.
Die Pressemitteilung des Europäischen Gerichtshofs zu den Schlussanträgen ist hier abrufbar (enthalten ist auch ein Link zum Volltext der Schlussanträge):